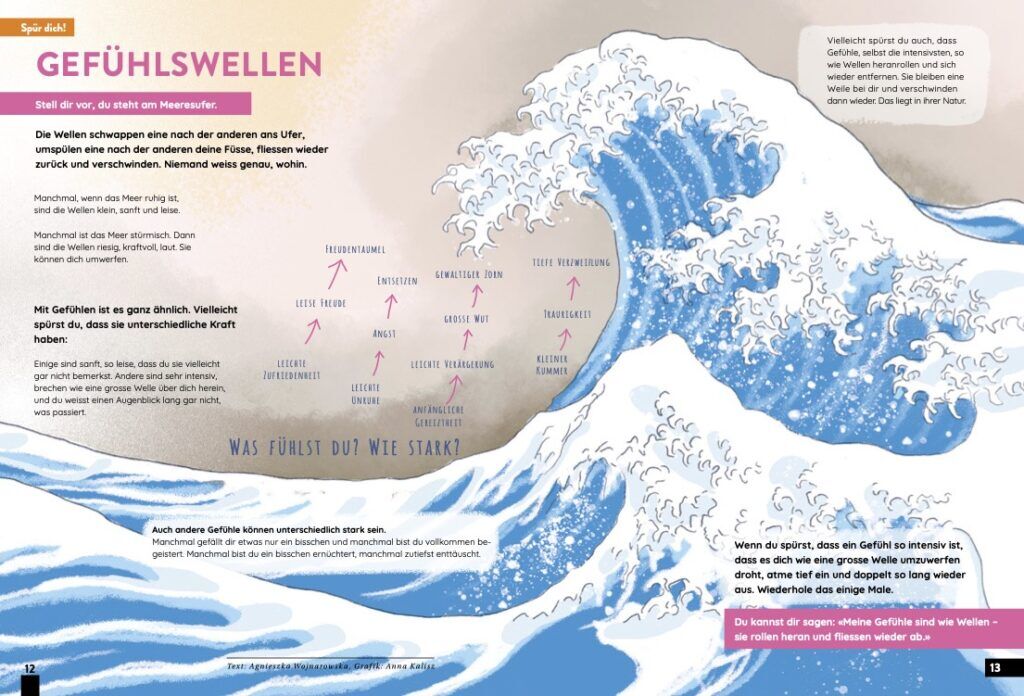Im Fokus
Genderstereotype: So prägen sie die Schweizer Gesellschaft und die Mädchen
Mädchen wird weniger zugetraut als Buben und sie wachsen umgeben von traditionellen Geschlechterrollen auf. Das sagt Gabriella Schmid, Professorin für soziale Arbeit an der Fachhochschule Ost in St. Gallen, im Interview.
KALEIO: Gabriella Schmid, in der Schweiz leben ungefähr 260 000 Mädchen zwischen 8 und 13. Was konkret wissen wir über sie?
Gabriella Schmid: Sehr wenig. Deshalb haben ich und mein Team vor fünf Jahren eine Studie gemacht, weil wir mehr über Mädchen herausfinden wollten. Leider ist es bei dieser einen Untersuchung geblieben, da wir keine Gelder für weitere Studien erhalten haben.
Wie erklären Sie sich das?
Ich glaube, es ist schlicht nicht mehr «in». Mittlerweile konzentriert sich der mediale und fachliche Diskurs stärker auf die Buben, die angeblich in der Schule benachteiligt werden. Das mag teilweise berechtigt sein, doch die Tatsache bleibt: Mädchen wird in der Schweiz weniger zugetraut. Geschlechterstereotype wie beispielsweise jenes, dass Mädchen weniger gut in Mathematik und im logischem Denken seien, behindern die Mädchen. Das Problem ist, dass es sich dabei um eine sehr subtile Form der Diskriminierung handelt.
Wenn diese so subtil ist, dann ist sie für die Mädchen vielleicht gar nicht so schlimm.
Ich glaube doch, denn sie können auf diese Weise ihr Potenzial nicht entfalten. Nehmen Sie beispielsweise die Berufswahl. Eine junge Frau entscheidet sich für eine Ausbildung und hat das Gefühl, sie tut dies, weil sie es will. Erst Jahre später merkt sie dann vielleicht, dass sie eigentlich eine Begabung für einen ganz anderen Beruf hätte und sie sich von Normen und Erwartungen in ihren Beruf hat drängen lassen.
«Während Mädchen noch nach den Sternen greifen, passen sich junge Frauen stark an die an sie gestellten Rollenerwartungen an.»
Was haben Sie in Ihrer Studie über Mädchen und junge Frauen herausgefunden, das Sie überrascht hat?
Mädchen vor der Pubertät sind extrem offen und unbeschwert. Sie wollen buchstäblich nach den Sternen greifen und trauen sich vieles zu. Sie benennen klar ihre Stärken, etwa dass sie gut in Mathe seien, und träumen davon, Pilotin zu werden. Es hat mich berührt, zu sehen, dass die Pubertät vieles verengt und dass Geschlechterstereotype stark an Bedeutung gewinnen. Junge Frauen, die wir befragt haben, gaben im Gegensatz zu den Mädchen beispielsweise an, dass sie hilfsbereit seien. Sie nehmen sich stärker zurück, man kann auch sagen, sie passen sich stärker an die Rollenerwartung an. Gefragt nach ihrem Traumberuf, nannten sie viel öfters typische Frauenberufe wie Kleinkinderzieherin. Und auf die Frage, wie sie später leben wollen, antworteten junge Frauen anders als Mädchen viel häufiger, dass sie zu Hause bleiben und sich überwiegend um die Kinder kümmern wollen.
Was ist denn problematisch daran, wenn Mädchen und junge Frauen sich später auf die Erziehung der Kinder fokussieren wollen?
Das Problem an diesem traditionellen Modell ist, dass es auf finanzieller Abhängigkeit vom Partner beruht. In vielen Fällen funktioniert das, aber es ist ein Risiko. Ein Risiko, in die Armut zu rutschen im Fall einer Trennung. Ausserdem haben Frauen, die finanziell abhängig sind, oft auch weniger Verhandlungsspielraum in der Partnerschaft. Das habe ich häufig erlebt in meiner über zehnjährigen Arbeit mit Frauen, die häusliche Gewalt erlebten. Viele trennten sich nicht von ihrem gewalttätigen Partner, weil sie nicht wussten, wie sie sich und ihre Kinder ohne ihn durchkriegen sollten.
«Die Schweiz ist immer noch ein konservatives Land, wo Geschlechterstereotypen sehr dominant sind.»
Wäre es da nicht wichtiger, die unbezahlte Arbeit – wie die Erziehung der Kinder oder die Pflege von älteren Familienmitgliedern – aufzuwerten anstatt Frauen zu drängen, einer Lohnarbeit nachzugehen?
Ich sage nicht, dass diese Arbeit weniger wert ist. Aber wir leben nun einmal in einer kapitalistischen Gesellschaft. Mädchen und junge Frauen sollten sich den Konsequenzen solcher Entscheidungen auf ihre finanzielle Lage stärker bewusst werden.
Zurück zu Ihrer Studie, in der sich zeigte, dass sich Mädchen stark fühlen und sich mehr zutrauen als junge Frauen. Wie erklären Sie sich diese, wie Sie es nennen, Verengung?
Ich erkläre mir das mit dem Umfeld und den fehlenden Vorbildern beziehungsweise zu wenig vielfältigen Rollenvorbildern für Mädchen. Die Schweiz ist immer noch ein konservatives Land, wo Geschlechterstereotypen sehr dominant sind. Die heranwachsenden Mädchen merken, dass Männer mehr zu sagen haben in unserer immer noch patriarchal geprägten Gesellschaft. Das hat man auch während der Corona-Krise gesehen. Es waren überwiegend Männer, die in den Medien erklärt haben, was getan werden muss. Subtil kriegen die Mädchen zu spüren, dass man ihnen weniger zutraut als den Buben und dass sie weniger geschätzt werden. Es liegt wirklich noch vieles im Argen.
Wer ist schuld daran, abgesehen von der fehlenden weiblichen Repräsentanz?
Für Mädchen ist die eigene Mutter ein Vorbild, sprich, auch das familiäre Umfeld hat einen grossen Einfluss. Aber auch Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen fördern oftmals unbewusst Geschlechterstereotypen, indem sie den Mädchen etwa weniger zutrauen in technischen und naturwissenschaftlichen Fächern. Und nicht zuletzt befeuert die Spielzeugindustrie die Trennung in zwei klar voneinander abgetrennte Welten. Rosa und Prinzessinnen für Mädchen, Blau und Action für Jungs. Auf diese Marketingstrategie setzt die Industrie verstärkt seit den Nullerjahren, davor war dies viel weniger der Fall. Hier hat ganz klar ein Rückschritt stattgefunden.
«Mädchen brauchen geschützte Räume, wo sie ihre Stärken und Fähigkeiten in Ruhe entdecken können.»
Was muss sich ändern, damit Mädchen in der Schweiz weniger in geschlechterstereotypische Schubladen gezwängt werden?
Mädchen brauchen unbedingt mehr diverse Rollenvorbilder, also auch Frauen, die nicht frauentypische Biografien haben und frauentypische Berufe ausüben. Lehrpersonen müssen unbedingt stärker auf das Thema sensibilisiert sein und den Schülerinnen und Schülern mehr Raum geben, um ihre persönlichen Fähigkeiten zu entfalten, ohne in Genderkategorien zu denken. Ausserdem braucht es Räume, wo Mädchen unter sich sind, zum Beispiel Mädchentreffs.
Sie fordern einerseits, dass das Geschlecht nicht so eine starke Rolle spielen soll in der Schule, andererseits aber auch Mädchentreffs. Ist das nicht ein Widerspruch?
Nein. Wenn Mädchen und Buben zusammen sind, gehen Mädchen oftmals unter oder nehmen sich rasch zurück. So können sie gar nicht herausfinden, ob sie zum Beispiel gut präsentieren können oder Spass daran haben, eine Gruppe zu leiten, weil diese Aufgaben gleich die Buben übernehmen oder die Mädchen sie ihnen abgeben. Verschiedene Studien zeigen, dass Frauen, die auf Mädchenschulen gingen, öfters naturwissenschaftliche Berufe wählen als Frauen, die auf einer gemischten Schule waren. Ich plädiere nicht für getrennte Schulen. Aber geschützte Räume, wo Mädchen ihre Stärken und Fähigkeiten in Ruhe entdecken können, sind extrem wichtig.