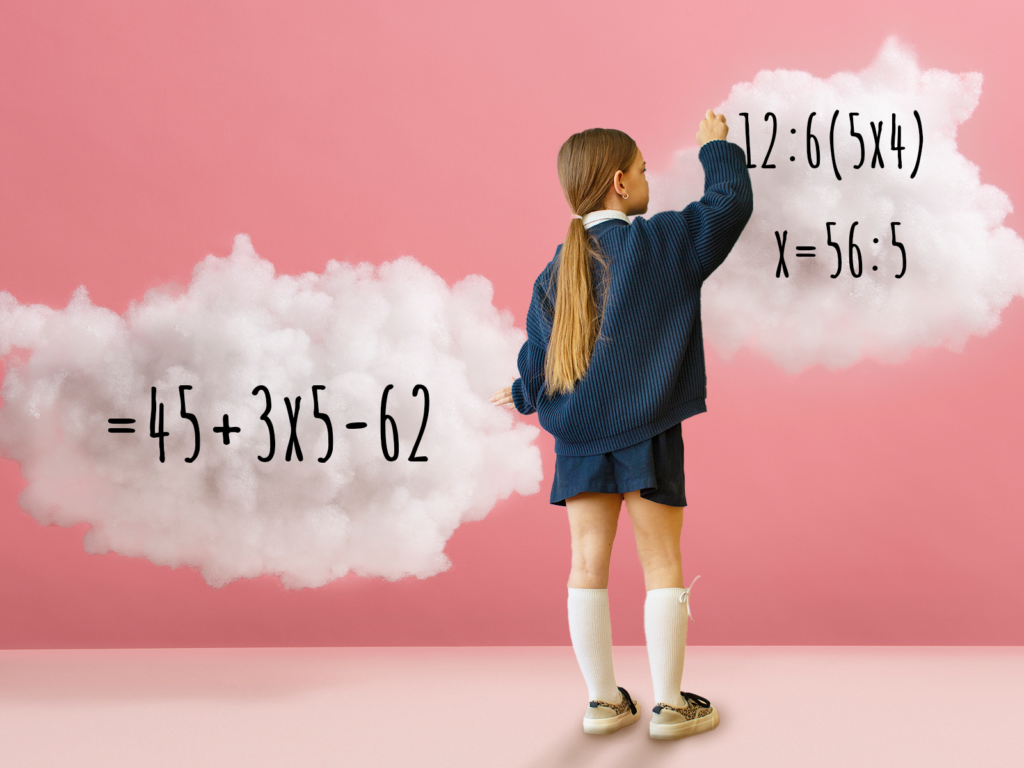Schule
Dieses Experiment enthüllt dein Bild von Wissenschaft!
Collage Titelbild: © Karolina Wojciechowska
Ich lade dich zu einem kleinen Experiment ein: Nimm ein Blatt Papier und einen Stift und zeichne eine Person, die forscht und wissenschaftliche Studien veröffentlicht. Keine Sorge, du musst kein Labor mit Erlenmeyer-Kolben skizzieren – es geht nur um die Person.
Fertig? Super! Jetzt schau dir deine Zeichnung genauer an. Wie sieht die Person aus? Hat sie zerzauste Haare? Trägt sie eine Brille und einen Laborkittel? Ist sie ein Mann?
Falls du diese Fragen mit «Ja» beantwortet hast, dann bestätigst du damit, was die DAST-Forschung («Draw a Scientist Test») seit Jahrzehnten belegt: Die meisten Menschen stellen sich eine forschende Person vor, die starke Ähnlichkeiten mit Albert Einstein hat.
Interessant sind die Erkenntnisse aus den USA: Während in DAST-Studien mit Kindergartenkindern rund 40 Prozent eine weibliche Wissenschaftlerin zeichnen, stellen Menschen ab 16 Jahren in den allermeisten Fällen einen Mann dar.
Dies verdeutlicht, wie stark das gesellschaftlich männlich geprägte Image von Forschung und MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) das Aufwachsen beeinflusst. Stereotype wie «Mathe ist für Jungen» oder umgekehrt «Mädchen sind besser in Sprachen und haben mehr soziale Fähigkeiten» prägen Kinder und Jugendliche – und wirken oft ein Leben lang nach.
Hast du Angst vor Mathe?
Viele erwachsene Frauen bejahen diese Frage und schätzen ihre mathematischen Fähigkeiten als eher schwach ein. Und: Diese Unsicherheiten werden (natürlich unbewusst!) an die nächste Generation weitergegeben – insbesondere an Mädchen. Und das nicht nur im Elternhaus, sondern auch in der Schule.
Untersuchungen der Universität Chicago zeigen, dass Primarschullehrerinnen, die sich selbst in Mathematik unsicher fühlen, diese Angst an ihre Schülerinnen weitergeben. An ihre Schüler hingegen nicht.
Die Konsequenz: Schon in der zweiten Klasse haben auch in der Schweiz viele Mädchen das Stereotyp verinnerlicht, dass Mathe nichts für sie ist – noch bevor es überhaupt messbare Leistungsunterschiede gibt.
Wie die PISA-Studie 2022 zeigt, schätzen 15-jährige Mädchen ihre mathematischen Fähigkeiten schlechter ein als Jungen, selbst wenn ihre tatsächlichen Leistungen vergleichbar sind. Diese negative Selbstwahrnehmung führt dazu, dass sie sich weniger mit dem Fach identifizieren, weniger Interesse und Motivation entwickeln und später Berufe im mathematisch-technischen Bereich meiden.
Doch diesen Teufelskreis können wir durchbrechen. Gerade in der Schule gibt es viele Möglichkeiten, stereotype Denkmuster zu hinterfragen und allen Kindern das Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten zu vermitteln.
KALEIO-Tipps für Lehrpersonen
(Für alle, die möchten, dass jedes Kind sein Potenzial voll entfalten kann.)
- Reflektiere deine Erwartungen: Überlege dir, welchen Kindern in deiner Klasse du besonders gute Leistungen in Mathematik (oder Sprache) zutraust – und warum. Auf welchen Annahmen basiert deine Einschätzung?
- Schaffe Chancengerechtigkeit: Achte darauf, dass Mädchen im Mathematikunterricht genauso viel Redezeit erhalten wie Jungen und dass du ihnen genauso ausführliches Feedback zu ihren Leistungen gibst.
- Überprüfe dein Unterrichtsmaterial: Werden Männer in den Bereichen Naturwissenschaften und Technik dargestellt, während Frauen eher in sozialen Berufen erscheinen? Falls ja, könnte es an der Zeit sein, ein anderes Lehrbuch zu wählen. Hier findest du eine Checkliste, die dir dabei hilft, Unterrichtsmaterialien auf Gendergerechtigkeit zu prüfen.
- Fördere spielerisch: Nutze das KALEIO-Magazin! In den Rubriken «Lilavatis Rätselperlen» und «Knack den Code» findest du spannende Aufgaben, die Freude an Mathematik und logischem Denken auf spielerische Weise fördern. Diese Rätsel und Denkaufgaben machen garantiert der ganzen Klasse Spass und nehmen die Berührungsangst vor Mathe.