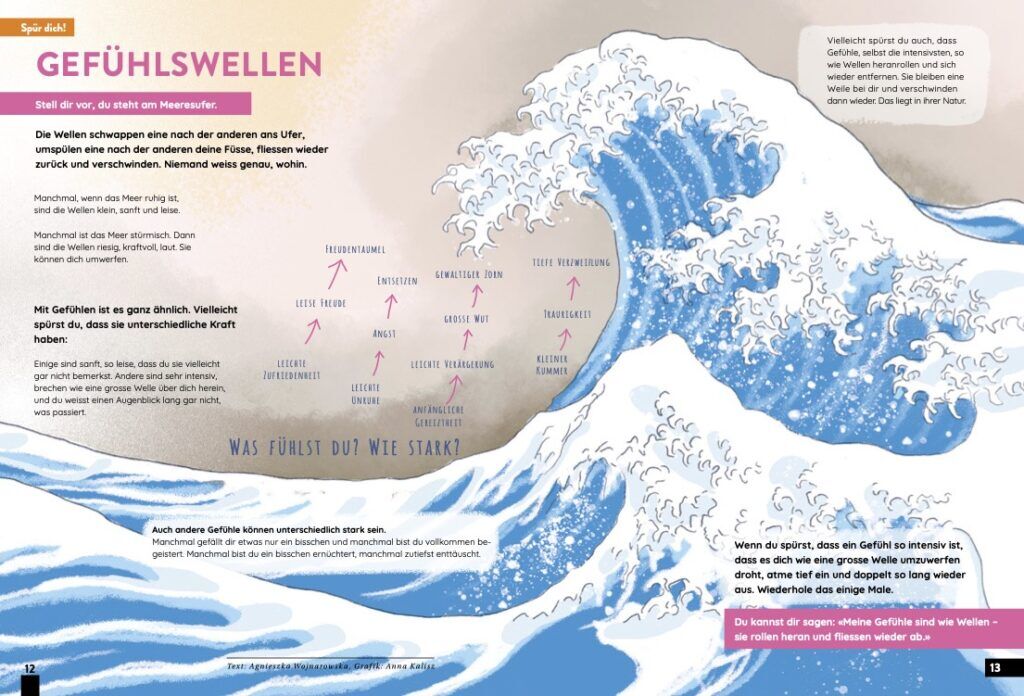Körper & Psyche
Ihr fürchtet euch nicht genug! Warum Halloween Eltern Angst machen sollte
Collage Titelbild © Anna Lach-Serediuk
Kinder, die unbeaufsichtigt mit dem Smartphone im Internet surfen, stossen gerade rund um Halloween oft (ungewollt) auf grausame Gewaltdarstellungen. Die meisten Eltern ahnen davon nichts, sagt Digitaltrainer Daniel Wolff. Seine Mission: Eltern aufklären und ihnen konkrete Werkzeuge an die Hand geben, um ihre Kinder besser zu schützen.
KALEIO: Halloween – mittlerweile fast so beliebt bei Kindern wie Weihnachten. Gruseln Sie sich auch gerne?
Daniel Wolff: Früher mal. Aber nach all dem, was ich inzwischen in meiner Arbeit mit Kindern erlebt habe, mag ich Halloween wirklich gar nicht mehr …
Warum denn nicht?
Weil jedes Jahr zu Halloween neue Horrorfilme erscheinen. Die meisten Erwachsenen wissen gar nicht, welche Grausamkeiten ein moderner Horrorfilm ab 18 heute überhaupt zeigt. Und sie wissen erst recht nicht, dass die schlimmsten Szenen davon heute regelmässig ungeschnitten auf YouTube kursieren. Und Kinder sind neugierig …
Das Internet ist nun einmal nicht für Kinder gemacht. Es gibt dort alles – aber keinerlei wirksamen Kinderschutz. Schon wer lediglich Zugang zu YouTube oder WhatsApp hat, hat Zugang zu allen Inhalten. Eltern unterschätzen das oft, weil sie selbst andere Erfahrungen mit den gleichen Apps gemacht haben.
Die Wahrheit ist aber: Leider sieht fast jedes Kind mit einem Smartphone eher früher als später Darstellungen extremer Gewalt im Internet. Nicht, weil es das absichtlich sucht – sondern durch Zufall. Spätestens, wenn der Klassenchat auf WhatsApp läuft, tauchen solche Inhalte immer wieder als Mutproben («Traust Du Dich, auf diesen Link zu klicken?») auf.
Und auf Kurzvideo-Diensten wie TikTok, YouTube Short oder Instagram Reels geht alles so schnell, dass die Kinder nicht rechtzeitig wegschauen können. Bevor sie entscheiden können, ob sie die grausame Szene überhaupt sehen wollen, haben sie sie schon gesehen! Nahezu alle Jugendlichen wissen das. Die meisten Eltern wissen jedoch nichts davon.
Warum wissen Erwachsene so wenig darüber?
Weil sie Whatsapp und Youtube selbst ganz anders nutzen, und weil die Algorithmen ihnen solche Inhalte fast nie zeigt – das wäre wohl eher geschäftsschädigend. Geben Sie – wenn Sie sich trauen – auf YouTube mal folgende Stichworte ein, die selbst sehr junge Kinder immer wieder nennen, und schauen sie sich ein paar Clips an, dann bekommen Sie einen Eindruck: Pennywise, Chucky, Annabel, Huggy Wuggy, Granny, Sirenhead, Jason oder Terrifier – die Liste ist endlos.
Ich glaube, dass Kindern solche Clips hin und wieder angezeigt werden, damit sie länger online bleiben. Denn genau das ist das Ziel der Plattformen: Maximale Nutzungszeit, denn jede zusätzliche Minute bedeutet mehr Werbeeinnahmen.
Viele Eltern sind überzeugt, dass ihre Kinder ihnen erzählen würden, wenn sie etwas Verstörendes gesehen haben.
Das mag in Einzelfällen stimmen, aber bei den allermeisten Kindern ist es anders. Ich habe in den letzten Jahren mit über 100’000 Kindern und Jugendlichen gesprochen. Sie sind mir gegenüber normalerweise recht offen, weil ich ihnen gleich zu Beginn erkläre, dass sie heute alles sagen dürfen – nichts wird bestraft – und dass ich ohnehin keinen einzigen Namen der Kinder kenne.
Was ich aus diesen Gesprächen weiss: Wenn ein Kind zum ersten Mal in seinem Leben etwas Schreckliches sieht, bekommt es nach dem ersten Schreck oft erst einmal ein schlechtes Gewissen. Es spürt, dass das nicht für es bestimmt war und fragt sich: Was mache ich jetzt? Meine Eltern haben mir nie davon erzählt, aber sie haben mir das Gerät gegeben.
Dann entsteht ein Konflikt: Haben sie mir nichts gesagt, weil sie es nicht wissen oder weil es sie nicht interessiert? Beides ist aus Kindersicht ziemlich schlimm. Und vor allem: Viele Kinder haben ganz einfach Angst, dass die Eltern ihnen das Handy wegnehmen, wenn sie davon erzählen!
«Medienerziehung ist in einer digitalen Welt voller Künstlicher Intelligenz eine der zentralen Erziehungsaufgaben geworden.»
Wann passieren solche Situationen am häufigsten?
Ich denke, ganz klar nachts. Kinder, die mit dem Smartphone ins Bett gehen – ob erlaubt oder heimlich –, schalten es oft auf nahezu lautlos oder setzen Kopfhörer auf – aber nur mit einem Ohr, um zu hören, ob die Eltern kommen. Viele dimmen auch den Bildschirm, damit die Eltern nichts bemerken. Dann beginnt ihre «Expedition» ins Internet. Sie segeln allein in den digitalen Ozean hinaus. Manchmal geht das gut, manchmal leider nicht. Und Kinder sind noch sehr verletzlich.
Was können Eltern tun, um ihre Kinder zu schützen?
Das Wichtigste: Keine Bildschirme im Schlafzimmer! Kein Smartphone im Bett – auch nicht als Wecker oder zum Podcast-Hören. Das gilt auch für die Eltern: Kinder beobachten das Verhalten der Eltern jahrelang und übernehmen es. Und auch Erwachsene schlafen ohne Smartphones besser …
Wäre es am sichersten, Kindern gar kein Smartphone zu geben?
Wir können nicht alles erlauben, aber auch nicht alles verbieten, denn wir müssen unsere Kinder ja auf die digitale Welt vorbereiten. Wir müssen irgendwo «durch die Mitte», und das wird tatsächlich richtig anstrengend – da sollten wir uns nichts vormachen. Medienerziehung ist in einer digitalen Welt voller Künstlicher Intelligenz eine der zentralen Erziehungsaufgaben geworden: Je früher Eltern das verstehen, desto besser!
Ab wann sollten Kinder ein Smartphone bekommen?
Die Übergabe eines Smartphones ist ein lebensverändernder Moment im Leben eines Kindes und muss gut vorbereitet sein. Aus meiner Erfahrung zeigen Jugendliche erst zwischen 14 und 16 Jahren die Reife, um zu erkennen, dass das ständige Scrollen und die enormen Nutzungszeiten ihnen schaden. Davor überwiegen Neugier und die Faszination für das endlose Feuerwerk aus Kurzvideos. Man sollte schon auch mit jüngeren Kindern ins Netz gehen, aber eben begleitet. Ein Smartphone lässt sich vom Formfaktor her nun einmal nicht begleiten: Jedes Kind kann sich auf dem Klo einsperren und alles ansehen, was es will.
Also kein Smartphone vor 14?
In einer Welt ohne Gruppendruck empfänden die meisten Eltern wohl ein Alter von etwa 14 Jahren ideal. Dann sind die Kids schon nicht mehr ganz so verwundbar. Social Media Apps, die auch Inhalte ab 18 ausspielen (wie Instagram, Snapchat und TikTok) kann man eigentlich ernsthaft frühestens ab 16 empfehlen. Aber ganz egal, wann Eltern ihr Kind ein Smartphone bekommen lassen – sie sollten sich trauen, ihm ein Versprechen geben: Dass sie es nie zur Strafe wegnehmen. Denn nur so wird das Kind sich trauen, zu ihnen zu kommen, wenn etwas passiert ist.
Ich empfehle ausserdem dringend, dass sich die Eltern vorher erst einmal untereinander einigen, wie das Gerät genutzt werden darf. Dann erstellen sie gemeinsam einen Mediennutzungsvertrag – Vorlagen gibt es auf mediennutzungsvertrag.de. Sie können Regeln streichen, hinzufügen und alles gemeinsam durchsprechen. Das dauert ein paar Stunden, ist aber enorm hilfreich. Anschließend bespricht man das Ganze in Ruhe mit seinem Nachwuchs und kann sich sicher sein, nichts Wesentliches vergessen zu haben! Und: Man muss es nur einmal komplett machen; danach reichen jährliche Anpassungen.
«Wie bei Alkohol oder Tabak brauchen wir endlich einen wirksamen Kinder- und Jugendschutz im Internet.»
Diese Situation verlangt Eltern, Kindern und Jugendlichen enorm viel ab.
Ja – und das ist zutiefst ungerecht. Würden die großen Social-Media-Plattformen nur einen winzigen Bruchteil ihrer multimilliardenschweren Profite für wirksamen Kinderschutz investieren, gäbe es längst wirksame technische Lösungen. Aber freiwillig wird das niemand tun; der Profit wird zu Lasten unserer Familien optimiert. Erst wenn den großen Digitalkonzernen mit App-Verboten gedroht wird, werden sie handeln.
Ich hoffe, dass wir als Gesellschaft bald so weit sind: Wie bei Alkohol oder Tabak brauchen wir endlich einen wirksamen Kinder- und Jugendschutz im Internet. Ich befürworte ausdrücklich auch eine feste Altersgrenze für Social-Media-Apps: Auch wenn sie umgangen werden kann, brauchen wir ihre Symbolwirkung, damit alle Eltern bald verstehen, dass Social-Media-Apps in ihrer heutigen Form vor allem jungen Kindern massiv schaden können. Und zwar nicht nur an Halloween.