Als ich zur Schule ging, gab es in meiner Klasse Kinder, die ein bisschen lauter waren als andere. Es gab solche, die ein bisschen schneller lernten, und solche, die ein bisschen länger brauchten. Kinder mit Trisomie 21 oder Kinder im Rollstuhl kannte ich keine. Das einzige Kind, das verhaltensmässig auffiel, musste nach einem Jahr in eine Kleinklasse wechseln. Auf dem Schulweg hatte ich es immer lustig mit ihm. Nach dem Wechsel hatten wir keinen Kontakt mehr.
Als ich in der aktuellen Ausgabe des Kaleio-Magazins das Interview mit der 13-jährigen Viola las, wurde mir bewusst: Die Schule hat sich in den letzten zehn, zwanzig Jahren stark verändert, zumindest was die Integration von Kindern mit einer Behinderung angeht. Viola sitzt im Rollstuhl und besucht die Schule in ihrem Dorf. Dank Hilfsmitteln treibt sie viel Sport und kann sich gut in die Klasse integrieren.
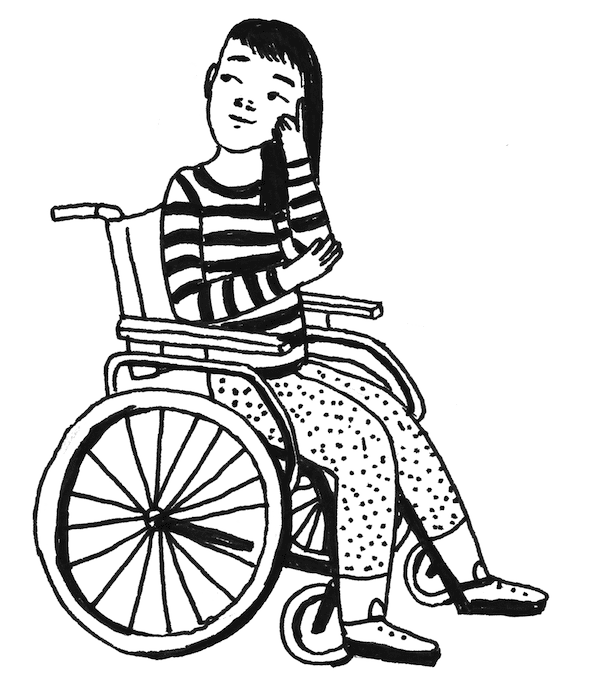
Umso überraschter war ich zu lesen, dass Violas Lehrerin einen Wechsel in eine Sonderschule vorschlägt. Ihre Begründung: Mit der Pubertät könnten die anderen Kinder Viola zunehmend ausschliessen. Dass Viola bislang keine schlechten Erfahrungen gemacht hat, scheint keine Rolle zu spielen. Das hat mich zum Nachdenken gebracht. Müsste es heute nicht selbstverständlich sein, Kinder mit körperlichen oder psychischen Behinderungen in der Regelklasse zu behalten?
Denn wie ich an mir selbst beobachten konnte, hat der fehlende frühe Kontakt zu Kindern mit einer Behinderung zu Vorurteilen geführt. Als Jugendliche kam ich auf dem Schulweg immer an einer Stiftung vorbei, in der Menschen mit psychischen Behinderungen arbeiteten. Auch wenn es mir heute unangenehm ist, das zuzugeben: Meistens fürchtete ich mich vor ihnen. Ihr Verhalten schien mir unberechenbar. Könnten Kontakte in der Schule nicht helfen, Verständnis zu schaffen? Für Kaleio habe ich mich auf die Suche nach Antworten gemacht.
Klassen werden sozialer durch Diversität
In der Schweiz gilt seit 2004 das Behindertengleichstellungsgesetz, das die Kantone verpflichtet, die schulische Integration von Kindern mit einer Behinderung zu fördern. Der Grundsatz lautet: Wenn es möglich ist und dem Wohle des Kindes entspricht, soll eine Integration in die Regelschule stattfinden. Unter diesen Integrationsauftrag fallen nicht nur Kinder mit einer körperlichen Beeinträchtigung wie Viola, sondern auch solche mit Autismus, psychischen Behinderungen oder Lernbehinderungen. Erhält ein Kind den sogenannten Sonderschulstatus, bekommt eine Schule gemäss den jeweiligen kantonalen Bestimmungen mehr Ressourcen, um es im Schulalltag zu fördern. Dies geschieht meist in Form zusätzlicher Lektionen durch eine Lehrperson mit heilpädagogischer Ausbildung.
Um mir ein Bild zu machen, wie gut das in der Praxis funktioniert, habe ich mit mehreren Lehrpersonen aus verschiedenen Schulstufen und Kantonen gesprochen. Alle befragten Personen wollten anonym bleiben, da sie die schulische Integration als politisch umstrittenes Thema sehen und sich nicht exponieren wollten. Fast alle berichten jedoch von sehr positiven Effekten im Schulalltag. Klassen mit integrierten Sonderschüler*innen seien tendenziell sozialer, hilfsbereiter und toleranter als solche ohne Sonderschüler*innen.

Vor allem auf Primar- und Mittelstufe scheint die Integration gut zu funktionieren. «Einige Kinder haben die Aufgabe der Helferinnen und Helfer übernommen», sagt etwa eine Primarlehrerin aus dem Kanton Solothurn, die ein Kind mit Trisomie 21 und ein Kind mit einer schweren Lernbehinderung in der Klasse hat. Je nach Befindlichkeit der beiden könne es zwar zu Eskalationen kommen. «Die Kinder haben dann die Aufgabe, mich zu holen oder das Verhalten möglichst nicht zu würdigen.»
Auch eine Kindergartenlehrerin aus dem Kanton Aargau erzählt, wie die soziale Integration eines Jungen mit Autismus zu ihrer eigenen Überraschung gut funktionierte: «Anfangs warf der Junge um sich, machte Spielzeug kaputt, biss uns.» Es habe einen grossen Einsatz aller Beteiligten gekostet, den Jungen an das neue Umfeld zu gewöhnen, sagt sie. «Mittlerweile ist er ruhiger. Die anderen Kinder mögen ihn und nehmen ihn auch mal an die Hand.»
Schwieriger kann es auf der Oberstufe werden, wenn die Interessen der Kinder auseinanderdriften. Solche Fälle kennt etwa Peter Lienhard, Dozent an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik. «Ein siebenjähriges Kind mit einer geistigen Behinderung findet noch Gleichaltrige, die mit ihm Uno spielen», sagt er. Wenn sich auf der Oberstufe aber plötzlich alle für Themen wie Partnerschaft oder Klimawandel interessieren, kann das laut Lienhard dazu führen, dass Kinder mit Behinderungen von sozialen Aktivitäten ausgeschlossen werden.
Lienhard berät Kantone und Schulen, wie sie Kinder mit Behinderungen integrieren können. Ob bei sozialen Konflikten in der Pubertät ein Wechsel in die Sonderschule angezeigt ist hängt gemäss seiner Erfahrung vom Kind selbst ab. «In der Regel können Kinder und Jugendliche selber einschätzen, ob sie das ‹fünfte Rad am Wagen› sind», so Lienhard. «Einige halten es fast nicht aus, dass sie anders sind, und sind froh um einen Wechsel in die Sonderschule. Andere kommen gut damit klar.»

Laut einer Heilpädagogin aus dem Kanton Bern erschwert nicht die Pubertät, sondern eher der Leistungsdruck die Integration. Dieser nehme auf der Oberstufe massiv zu. «Es kommt zu einem Konkurrenzkampf, in dem die Unterschiede zwischen den integrierten Kindern und den anderen stärker ins Gewicht fallen», so die Heilpädagogin. Sie betont aber, dass die Integration auch auf dieser Schulstufe mehrheitlich gut funktioniere.
Noch keine Selbstverständlichkeit
Der Blick in die Klassenzimmer zeigt: Trotz sozialen Konflikten und Leistungsdruck empfinden die meisten Lehrpersonen die Integration als Bereicherung und erhoffen sich positive Effekte auf die Gesellschaft. Ein drängendes Thema sind jedoch die Ressourcen. Weil die Anzahl zusätzlicher Förderlektionen oft knapp bemessen ist, stellt der Integrationsauftrag für viele einen Zusatzaufwand dar, der zur Belastung werden kann. Der Dachverband der Schweizer Lehrerinnen und Lehrer kritisiert dies seit Längerem. Lehrpersonen müssten einen Spagat schaffen, sagt dessen Zentralpräsidentin Dagmar Rösler. «Einerseits müssen sie den Anforderungen der Leistungsgesellschaft und andererseits den Kindern mit besonderen Bedürfnissen gerecht werden.»
Kommt hinzu, dass sich der Integrationsgedanke nicht überall durchgesetzt hat. Erst kürzlich hat eine Studie des Schweizerischen Zentrums für Heilpädagogik erstmals umfassend das Angebot an integrativen und separativen Schulangeboten für Kinder mit Behinderungen untersucht und grosse kantonale Unterschiede festgestellt. So gibt es noch in der Hälfte der Kantone Sonderklassen. Und trotz einem Ausbau an integrativen Angeboten prognostizieren die Kantone gemäss der Studie sogar eine Zunahme an Sonderschulen in den nächsten Jahren.
Es zeigt sich also ein gemischtes Bild. Auch wenn viele Lehrpersonen hinter dem Integrationsgedanken stehen, ist die Integration heute nicht einfach eine Selbstverständlichkeit. In der Praxis erfordert sie viel Engagement der Schulen und der Eltern. Ich bin deshalb skeptisch, ob die gesellschaftlichen Vorurteile, die ich an mir selber beobachtet habe, unter den aktuellen Bedingungen abgebaut werden können. Und inwiefern entspricht der Wunsch nach mehr Kontakten in der Schule überhaupt den Bedürfnissen von Kindern mit einer Behinderung? Was braucht es, damit sie von der integrativen Schule profitieren können? Auf diese Fragen wird eine betroffene Familie Kaleio zu einem späteren Zeitpunkt eine ganz persönliche Antwort geben.







 Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb. 



